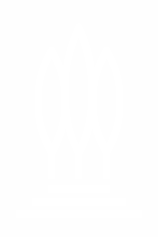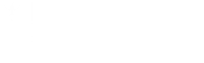Im September 2025 jährte sich der Geburtstag der Fürstin Louise von Anhalt-Dessau zum 275. Mal – Grund genug für ein kleines Geschenk aus dem Reich der Literaturgeschichte.
Obwohl bereits die (Reise-)Tagebücher und auch einige der Briefe Louises erschlossen und ediert worden sind, existieren doch noch zahlreiche handschriftliche Zeugnisse, die in den Archiven darauf warten, gelesen zu werden. Diese geben in vielfältiger Art und Weise Aufschluss über das Leben, Befinden, die Betätigungsfelder, Kontakte und Freundschaften der Fürstin.
Bekanntlich pflegte die Fürstin den schriftlichen Dialog mit zahlreichen Schriftstellerinnen und Künstlerinnen ihrer Zeit. Dazu gehört auch der zugegebenermaßen überschaubare, aber nicht minder interessante Austausch mit der Dichterin Anna Louisa Karsch. 1722 in Schlesien geboren und in ihrer Jugend als Rinderhirtin arbeitend, machte Karsch aufgrund ihres enormen poetischen Talents und ihrer faszinierenden Gabe, aus dem Stehgreif dichten zu können, in Berlin auf sich aufmerksam und wurde in den dortigen Dichter- und Gelehrtenkreisen als Naturgenie und ‚preußische Sappho‘ gefeiert. 1764 erschienen ihre „Auserlesenen Gedichte“, die sich auch im Besitz des Fürsten von Anhalt-Dessau befanden.
Zahlreichen zeitgenössischen Herrschern (und Herrscherinnen) widmete Karsch Gelegenheitsgedichte und panegyrische Lyrik. Popularität erlangte sie nicht zuletzt durch ihre zahlreichen Gesänge auf die Schlachten und Siege des preußischen Königs Friedrich II. Doch auch weniger kriegerisch ambitionierte Persönlichkeiten und friedlichere Anlässe wurden von Karsch in der Form von Gedichten gefeiert. Dem Fürstenpaar von Anhalt-Dessau übersandte sie 1770 zur Geburt des Erbprinzen Friedrich, der Ende Dezember 1769 das Licht der Welt erblickt hatte, einen „Gesang bey der Fürstlichen Wiege des neugebohrnen Erb-Prinzen von Anhalt-Dessau“. Im Gleimhaus Halberstadt – Museum der deutschen Aufklärung befindet sich die Antwort der Fürstin, in dem diese unter anderem der „gute[n] Frau Karschin“ für die „sanffte Melodie“ des „Wiegenliedes“ dankt und wünscht: „lange lange noch möge Ihr die Kraft zum Singen bleiben. Dieses wünschet auch der Fürst welcher nebst mir Seinen Dank abstattet.“ (Sign. Hs A 43).
Eine preußische Prinzessin und eine aus ärmlichen Verhältnissen stammende Dichterin - beide in ihrer Herkunft und Prägung so verschiedene Frauen müssen sich dennoch gemocht haben. In einem in der Sammlung Varnhagen in Krakau überlieferten Schreiben vom 4. November 1772, dem ein nicht bekannter Brief der Karsch mit „recht guten Wünschen“ und einer nicht näher beschriebenen Gabe – vermutlich ein Gedicht – vorausgegangen war, notierte die Fürstin: „Meine liebe Frau Karschin. Sie kann es laut sagen, daß ich ihre Muse liebe“. (Jagiellonen-Bibliothek Krakau, Slg. Varnhagen, Sign. 7). Außerdem spricht sie von einer „besondere[n] Zuneigung“ für Karsch. Bereits in einem auf den 24. August 1771 datierten Gedicht hatte Karsch die Fürstin als zentrale Inspiration des Wörlitzer Gartens gefeiert. In den Versen „Auf Ihro königl. Hoheit die Fürstin von Anhalt Dessau“, die 1774 in den „Neuen Gedichten“ erschienen, steht unter anderem zu lesen:
Und hörts, sie machte Leopolden
Sein Dessau zum Elysium.
Er ward von ihr geliebt, als ein arkadischer Hirte,
Er flocht ihr Blumen in ihr lockigt Haar,
Und sie wand einen Kranz von Myrte,
Die jugendgrün und knospigt war,
Um sein friedselig Haupt, und sagte:
Wohl mir, daß du, mein lieber Fürst,
Nie nach dem Kranze ringen wirst,
Um welchen Hektor einst sein muntres Leben wagte,
So bitter sich auch über ihn
Andromache, sein armes Weib beklagte.
Nein, du wirst nie mit der Bellona ziehn,
Mars wird dich nie von meinem Arme trennen.
Dein Unterthan wird stets im Freudenton
Dich segnen, und dich Vater nennen.
(Anna Louisa Karsch, Neue Gedichte, 1774, S. 69)
Das Bild von „Vater Franz“, der den Gottheiten Mars und Bellona eine Absage erteilt und nicht den Krieg, sondern den Garten als Schauplatz wählt und dafür von seiner jungen Gattin wie ein „arkadischer Hirte“ geliebt wird, ist hier bereits fest etabliert und lyrisch verewigt. Ob der Fürst und die Fürstin das Gedicht schätzten, ist nicht überliefert, aber sehr wahrscheinlich. Schließlich hat es Anna Louisa Karsch als einzige Frau bzw. weibliche Dichterin auf eine der Wände der Wörlitzer Schlossbibliothek geschafft.
PD Dr. Jana Kittelmann
Referat Kunstforschung und Sammlung/Abteilung Schlösser und Sammlungen
Titelbild: Bibliothek im Schloss Wörlitz © KsDW, Peter Dafinger